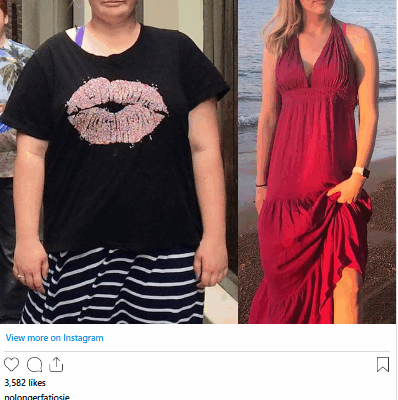Die plötzliche Absage an das Nachtleben

Noch vor wenigen Monaten postete Shurjoka Selfies aus Berliner Clubs; heute sagt sie kategorisch: „Ich gehe auf keine Partys mehr.“ Ausgesprochen hat sie das in einem spontanen Livestream Anfang Oktober – vor mehr als 15 000 Zuschauern, die ihre Worte clippten und teilten. Seither steht der Begriff „Naziparty“ als Meme in den Timelines.
Während ihr Chat zunächst mit Lach-Emojis reagierte, wurde schnell klar, dass die Streamerin es ernst meint. Geburtstagsfeiern von Freunden? Abgesagt. Firmen-Events? Ebenfalls. Selbst Gamescom-Aftershows, bei denen sie früher Stammgast war, kommen nicht mehr infrage. Der Grund: die diffuse Angst, unverhofft neben Rechtsextremisten zu stehen.
Weiter geht’s mit den Originalzitaten, die den Shitstorm lostraten.
Was Shurjoka wirklich gesagt hat

„In Deutschland kannst du in jedem Rewe einem Nazi begegnen“, erklärte sie in ihrem Stream. „Aber organisierte Events sind ein Hotspot, da geh’ ich nicht hin.“ Ihre Wortwahl war drastisch: Sie spreche von „Menschen, die Mordfantasien gegen mich haben könnten“. Die 27-Jährige bezeichnete sich selbst als „lebende Zielscheibe“ und wolle keine „Location Tag“ liefern, der rechten Trollen ihr Kommen verrät.
Interessant ist die Erweiterung ihrer Boykottliste: Nicht nur öffentliche Veranstaltungen, sondern auch private Feiern im Freundeskreis will sie meiden, falls Gäste ohne klares politisches Profil eingeladen sind. Damit zieht sie eine persönliche rote Linie, die in der deutschen Influencer-Szene einmalig ist.
Warum ihr radikaler Schritt auf so unterschiedliche Reaktionen stößt, klären wir gleich.
Applaus von links – und Stirnrunzeln bei der Community

Linke Aktivist*innen loben den Verzicht als „konsequenten Antifaschismus“. Für sie setzt Shurjoka ein Zeichen: Wer Rechtsextremismus toleriert, muss mit sozialer Isolation rechnen. In feministischen Kreisen kursiert schon der Hashtag #PartyBoykott als Solidaritäts-Geste.
Doch selbst langjährige Fans fühlen sich unwohl. Einige verweisen auf Paranoia, andere fürchten, dass die Streamerin in ihrer Filterblase versinkt. Auf X/Twitter nutzten rechte Influencer die Gelegenheit, sie als „hysterische Panikmacherin“ zu brandmarken und lockten ihre Follower mit Spott-Clips und „Invite Shurjoka“-Partyflyern.
Im nächsten Slide werfen wir einen Blick darauf, ob ihre Angst tatsächlich realistisch ist.
Warum die Angst vor Nazis in Clubs nicht völlig aus der Luft gegriffen ist

Sicherheitsbehörden warnen seit Jahren vor Rechtsextremen, die sich in Pop-Kultur-Milieus einnisten – vom Techno-Keller bis zum E-Sport-Event. Berichte über Hakenkreuz-Sticker in Berliner Clubs und rechtsextreme Chatgruppen in Gaming-Communities belegen, dass die Szene längst versucht, Mainstream-Veranstaltungen zu kapern.
Auch Shurjokas persönliche Erfahrung spielt hinein: Sie erhielt Morddrohungen nach kontroversen Streams über den Gazakrieg. Dass einige dieser Drohungen aus derselben Stadt kamen, in der sie auflegt, verstärkte ihren Rückzug. Für Außenstehende klingt das radikal, für sie ist es schlicht Selbstschutz.
Doch was bedeutet der Boykott nun für ihre Karriere?
Konsequenzen für Karriere und Partnerschaften

Erste Sponsoren reagierten nervös, weil geplante Meet-and-Greets auf Messen platzen. Gleichzeitig melden sich linke NGOs und bitten Shurjoka um Auftritte bei Online-Panels – sichere Räume, in denen sie ihre Botschaft verbreiten kann. Ihre Zuschauerzahlen auf Twitch stiegen nach der Ankündigung um 12 Prozent, was zeigt: Kontroverse ist Reichweite
Intern verrät ihr Management, dass Merch mit der Aufschrift „Keine Party für Nazis“ in Vorbereitung ist. Auch ein Charity-Event zugunsten von Aussteigerprogrammen für Rechtsextreme soll noch vor Weihnachten auf ihrem Kanal stattfinden – komplett digital, versteht sich.
Bleibt die Frage, ob ihr Beispiel andere Influencer inspirieren wird oder eine Einzelaktion bleibt.
Die große Frage: Wird der Boykott Schule machen?
In Discord-Servern größerer Streamer wird bereits diskutiert, gemeinsame „Safe Space-Events“ ohne Präsenzpublikum aufzuziehen. Einige Gaming-Studios denken darüber nach, VIP-Bereiche nur noch mit Verhaltenskodex zu öffnen. Sollte Shurjokas Schritt Wellen schlagen, könnte er den Umgang mit Fan-Events dauerhaft verändern.
Noch ist unklar, ob der Trend zündet oder verpufft. Sicher ist jedoch: Die Debatte über Rechtsextremismus im Entertainment-Kosmos ist damit endgültig in die Club- und Party-Kultur vorgedrungen – und Shurjoka hat diesen Diskurs lautstark gestartet.
Ob die Branche tatsächlich umdenkt, wird sich schon auf der nächsten großen Messe zeigen – warten wir es ab.