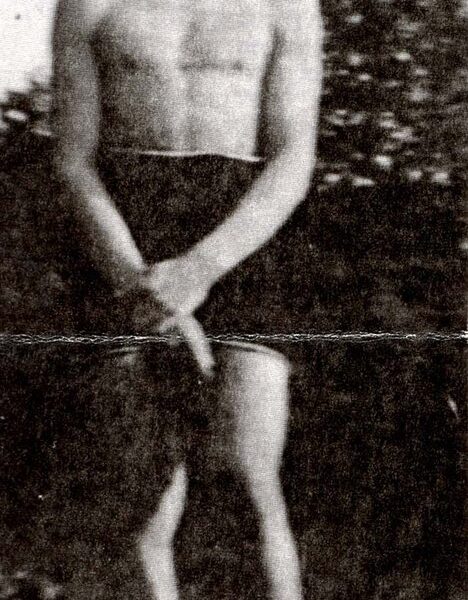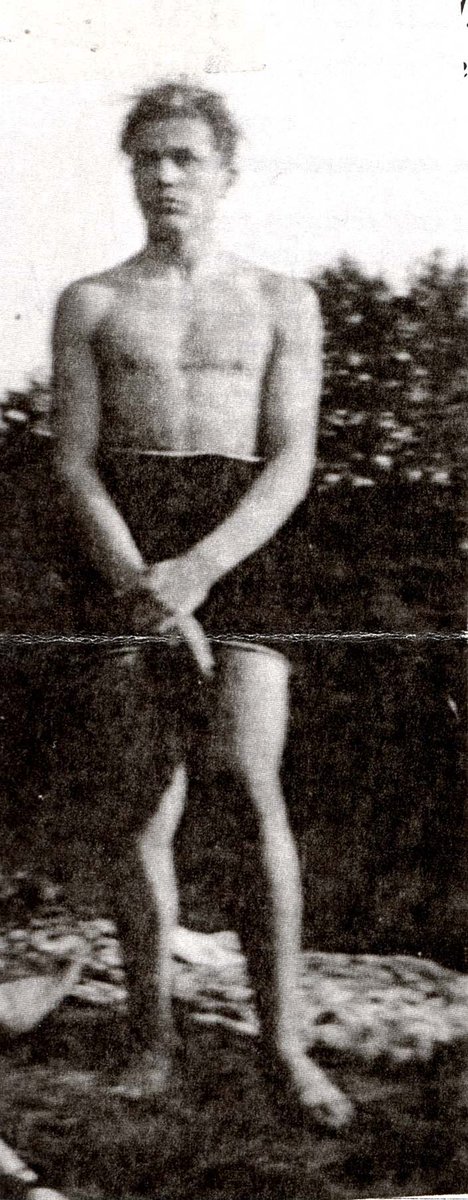
Am 12. Juli 1919 wurde Kurt Bachrach, ein deutscher Jude, in dem kleinen Ort Schwalenberg geboren – eine beschauliche Stadt in Nordrhein-Westfalen, die damals kaum ahnen konnte, welch düsterer Wandel Deutschland in den folgenden Jahrzehnten bevorstehen würde.
Kurt wuchs in der Weimarer Republik auf – einer Zeit politischer Unsicherheit, aber auch kultureller Vielfalt und Hoffnung. Als jüdischer Junge in der deutschen Gesellschaft dieser Jahre erlebte er vermutlich eine Kindheit, die noch vom Vertrauen in das Vaterland geprägt war. Doch mit dem Erstarken des Nationalsozialismus änderte sich alles.
Irgendwann in den 1930er-Jahren emigrierte Kurt in die Niederlande, wahrscheinlich auf der Suche nach Sicherheit, fern vom wachsenden Antisemitismus in Deutschland. Wie viele andere glaubte er vermutlich, dass er dort in Sicherheit sei – in einem neutralen Land, das traditionell Zuflucht für Verfolgte geboten hatte.
Doch die Hoffnung war trügerisch. Nach der Besetzung der Niederlande durch Nazi-Deutschland im Mai 1940 verschlechterte sich die Lage rapide. Jüdische Emigranten wurden erfasst, entrechtet und schließlich deportiert. Für Kurt bedeutete das: kein Entkommen mehr.
Im Jahr 1943 – das genaue Datum bleibt unklar – wurde Kurt Bachrach nach Auschwitz deportiert. Wahrscheinlich über das Durchgangslager Westerbork, wie es bei den meisten in den Niederlanden lebenden Juden der Fall war. Dort, im größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager, verlor sich seine Spur.
Er überlebte nicht. Wie so viele Millionen andere auch, wurde er zu einer Nummer, zu einem Eintrag in einer Transportliste – und schließlich zu einem der ungezählten Opfer, die nie zurückkehrten.
Heute erinnert kaum etwas an Kurt Bachrach – vielleicht ein verblasstes Foto, vielleicht ein Eintrag in einer Opferdatenbank. Doch jedes Leben, das ausgelöscht wurde, verdient es, erinnert zu werden. Kurt war mehr als ein Opfer – er war ein Sohn, vielleicht ein Bruder, vielleicht ein Freund. Und er war ein Mensch, der in einer Welt geboren wurde, die ihn am Ende verleugnete, verfolgte und vernichtete.
Wir erinnern uns an ihn – nicht nur als Opfer, sondern als ein Individuum mit Namen, mit Herkunft, mit Geschichte.